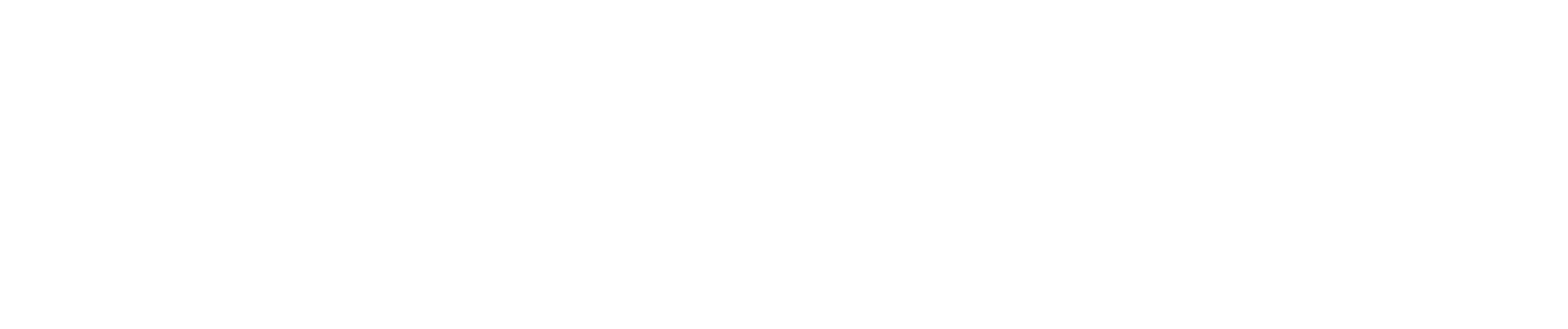Kreditportfoliomodelle – Wie Banken das Risiko im Griff behalten
07. Oktober 2025
Banken stehen permanent unter Risikodruck – Kreditrisiken sind dabei nur eine Facette. Portfoliomodelle helfen, Kreditrisiken messbar und planbar zu machen: Sie zeigen, welche Verluste wahrscheinlich sind und wie schlimm es im Extremfall werden könnte. Doch sie haben Grenzen, denn sie basieren auf Vergangenheitsdaten und können die Zukunft nur bedingt abbilden. In diesem Beitrag erklärt Lars Holzgraefe, wie diese Modelle funktionieren und warum ein Kreditportfolio wie ein Garten gepflegt werden muss: Vielfalt schützt vor Stürmen.

Banken sind vielfältigen Arten von Risiken ausgesetzt – und ständig kommen neue hinzu. Immer, wenn spektakuläre Krisen auftreten, reagiert die Bankenaufsicht mit erweiterten regulatorischen Vorgaben. So führte die Pleite der Baring Bank 1995 zu den Mindestanforderungen Handelsgeschäft (MaH). Die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK) wurden 2002 von der BaFin veröffentlicht. Sie legten verbindliche Standards für das Kreditwesen fest. Anders als bei der MaH war die MaK keine unmittelbare Reaktion auf einen spektakulären Zusammenbruch, sondern eine Lehre aus den Schäden von 1995.
Seitdem begleiten Regelwerke wie Basel II, MaRisk, Basel III die Steuerung von Banken kontinuierlich. Die Steuerung von Kreditrisiken, die mit den MaK ihren Anfang nahm, ist dabei ein zentraler Bestandteil.
________________________________________
Der einzelne Kunde und das Portfolio
Stellen Sie sich vor, Sie verleihen Geld an drei Freunde: einen Lehrer, einen Start-up-Gründer und einen Bauarbeiter. Jeder von ihnen hat ein anderes Einkommen, andere Sicherheiten und ein unterschiedliches Risiko, das Geld nicht zurückzuzahlen.
Für jeden werden individuelle Konditionen kalkuliert, die persönliche Umstände berücksichtigen – vom Vermögen über das Einkommen. Dieses Vorgehen nennt man risk-adjusted Pricing. Auf diese Weise lassen sich die erwarteten Verluste einzelner Kredite steuern.
Doch niemand kann garantieren, dass alle Kunden wie erwartet handeln. Hier kommt das Prinzip der Diversifikation ins Spiel: Verteilen Banken ihre Kredite auf viele Kunden, Branchen und Regionen, verringert sich das Risiko einzelner Ausfälle. Man kann sich das wie einen Garten vorstellen: Ein reiner Buchsbaumgarten ist riskant, falls der Buchsbaumzünsler einfällt. Hat man hingegen zusätzlich noch Rosenstöcke, Obstbäume und Staudenbeete, bleibt der Schaden insgesamt überschaubar.
________________________________________
Die Risiken hinter Krediten
Im Kreditgeschäft gibt es einige typische „Zünsler“:
- Kreditausfallrisiko: Der Klassiker. Ein Schuldner zahlt nicht zurück – im schlimmsten Fall viele gleichzeitig.
- Adressrisiko: Die Verfeinerung des Kreditausfallrisikos. Der Wert eines Kredits sinkt durch eine Verschlechterung der Bonität oder Sicherheiten. Das kann mehrere Kunden gleichzeitig betreffen.
- Konzentrationsrisiko: Entsteht, wenn eine Bank zu stark auf eine Branche oder Region setzt. Beispiel: Baufinanzierungen in Spanien vor der Finanzkrise 2008 oder wenn eine Stadt nur einen Arbeitgeber hat.
- Systemisches Risiko: Risiken, die das gesamte Finanzsystem betreffen – etwa Rezessionen oder Pandemien.
Man kann es sich wie das Wetter vorstellen: Ein kurzer Regenschauer ist unbedenklich, ein schwerer Sturm hingegen kann ernsthafte Folgen haben.
________________________________________
Warum Modelle wichtig sind
Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber Banken müssen wissen: Welche Verluste sind wahrscheinlich? Wie schlimm könnte es im Extremfall werden?
Hier kommen Kreditportfoliomodelle ins Spiel. Sie messen Risiken, quantifizieren sie und liefern Entscheidungsgrundlagen für die Bank.
________________________________________
Bausteine eines Kreditportfoliomodells
Jedes Modell hat drei zentrale Bausteine:
- PD – Probability of Default: Wie wahrscheinlich ist ein Kreditausfall?
- EAD – Exposure at Default: Wie viel Geld ist im Spiel?
- LGD – Loss Given Default: Wie hoch ist der tatsächliche Verlust im Ausfallfall?
Der kniffligste Teil: Korrelationen zwischen Kreditnehmern. Kredite fallen nicht unabhängig voneinander aus. Wenn eine große Fabrik in einer Stadt schließt, können gleich mehrere Kredite betroffen sein. Modelle müssen dies berücksichtigen.
________________________________________
Verschiedene Modelltypen
Einfache Modelle: Durchschnittswerte und Faustregeln – wie ein Kochrezept.
- Faktormodelle: Analysieren, wie Kreditausfälle mit wirtschaftlichen Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder Zinsniveau zusammenhängen.
- Monte-Carlo-Simulationen: Computersimulationen, die Millionen Szenarien durchspielen – ein bisschen wie Würfeln, nur ernst.
- Historische Simulation: Betrachtet die Vergangenheit: Was ist das Schlimmste, das bisher passiert ist, und was, wenn es morgen wieder passiert?
Das Ergebnis ist meist der Credit Value at Risk (CredVaR): Er zeigt an, welcher Verlust mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. In dieser Höhe muss die Bank Eigenkapital vorhalten – der Sicherheitsgurt der Bank.
________________________________________
Praxisbeispiel: VR-Control und Kreditportfoliomodelle
Die an Atruvia AG angeschlossenen Banken steuern Kredit- und Adressrisiken meist mit VR-Control. Kernstück von VR-Control KRM ist die Kreditstrukturanalyse, die Konzentrationen auf einzelne Kunden, Banken oder Regionen aufzeigt.
Um Risiken zu quantifizieren, nutzen die Banken in VR-Control das Kreditportfoliomodell Kundengeschäft barwertig:
- Ein Simulationsmodell berechnet eine Verlustverteilung aus verschiedenen Inputdaten.
- Daraus wird der Credit Value at Risk für ein vorgegebenes Konfidenzniveau bestimmt.
Verlustverteilungen im Kreditrisiko sind typischerweise rechtsschief. Dies bedeutet: Hohe Wahrscheinlichkeit kleiner, unkritischer Verluste, geringe Wahrscheinlichkeit extrem hoher, existenzbedrohender Verluste.
VR-Control KRM deckt folgende Risiken ab:
- Idiosynkratisches Migrationsrisiko: Bonitätsverschlechterung einzelner Kreditnehmer
- Systematisches Migrationsrisiko: Breite Verschlechterung der Bonität
- Idiosynkratisches Verlustrisiko: Höhere Verluste bei Ausfall eines einzelnen Kreditnehmers
- Systematisches Verlustrisiko: Anstieg der Verluste bei Ausfall vieler Kreditnehmer
Frühere Versionen unterschätzten Verlustrisiken aus Sicht der Aufsicht. Deshalb gab es seitens der parcIT Sicherheitsaufschläge und Erweiterungen. 2024 wurde das Modell durch die Bundesbank geprüft; im Ergebnis gab es eine Reihe von Prüfungsfeststellungen, diese wurden mit dem aktuellen VR-Control-Release 10 von der parcIT behoben oder reduziert.
Problematisch aus Bankensicht ist dabei: Der CredVaR steigt mit jeder Version an und liegt dabei oft deutlich über den in der Vergangenheit tatsächlich eingetretenen Schäden. Die Werte wirken aus Bankensicht daher als sehr konservativ kalkuliert. Positiv formuliert führt dies zu einer großzügigen Absicherung von Risiken. Aus Banksicht negativ ist die zunehmende Verknappung des Eigenkapitals.
________________________________________
Grenzen der Modelle
Modelle sind keine Kristallkugeln. Sie basieren auf historischen Daten – die Zukunft kann anders aussehen. Die Finanzkrise 2008 zeigte, dass Korrelationen zwischen Krediten und damit auch die daraus resultierenden Risiken stark unterschätzt werden können. Modelle können aber auch zu hohe Risiken anzeigen, was die Handlungsfähigkeit der Bank einschränkt.
________________________________________
Fazit
Ein Kreditportfolio ist wie ein gut gepflegter Garten: Vielfalt schützt vor Stürmen, regelmäßige Pflege ist Pflicht. Kreditportfoliomodelle helfen Banken, Risiken zu messen, das Geschäft planbarer und sicherer zu machen. Perfekt sind sie nicht – aber ohne sie wäre Bankensteuerung wie Autofahren ohne Bremsen.
Für die aktive Steuerung von Kreditrisiken allein reichen Modelle nicht aus. Sie müssen durch Risikofrüherkennung und andere Maßnahmen ergänzt werden.
Lars Holzgraefe ist Berater bei guides.consulting. Mit Kreditportfoliomodellen beschäftigt er sich seit seinem ersten Arbeitstag vor 26 Jahren. Und beim Schreiben dieses Blogbeitrags hat er feststellen müssen, wie schwierig es ist, etwas zu erklären, was einem seit vielen Jahren zumindest einigermaßen vertraut ist.