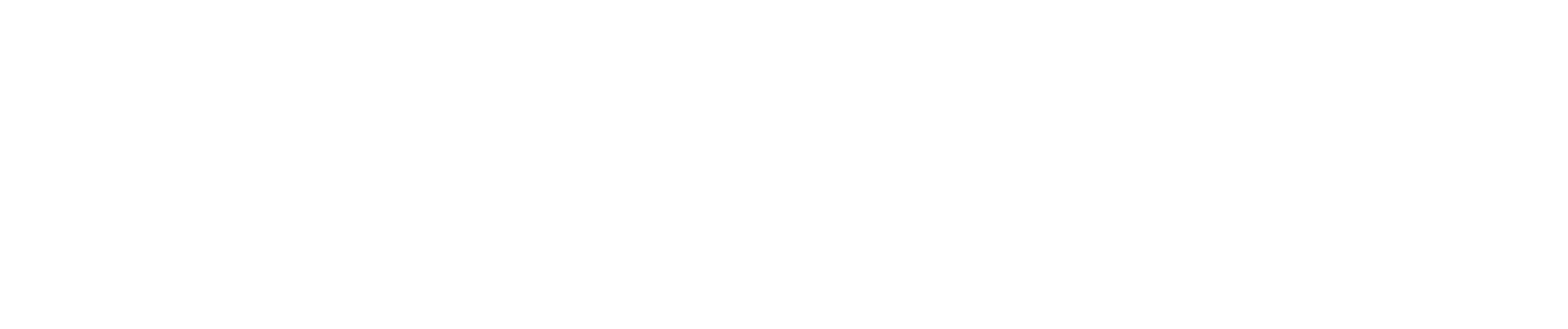Zwischen Regulatorik und Realität: Das Dilemma der Kundengeschäftsbewertung
24. November 2025
VR-Control CBS ist mindestens in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken Marktstandard für die Bewertung von Kundengeschäften. Die Kalkulation basiert auf der Marktzinsmethode und berücksichtigt Zins, Liquiditätsspread, kalkulatorische Risikokosten, Standardstückkosten und Eigenkapitalkosten. Praktisch führen marktgängige Konditionen jedoch regelmäßig zu negativen Margen, was regulatorisch problematisch ist. Hauptursachen sind hohe Liquiditätsspreads, RWA-basierte Eigenkapitalkosten und potenziell konservativ angesetzte Risikoparameter. Von einer Zielmargen-Iteration auf der Aktivseite sollte Abstand genommen werden, sinnvoll ist aber die Parametrisierung der Liquiditäts- und Eigenkapitalkosten, um eine Historie der Komponenten zu sichern.
VR-Control CBS ist ein Marktstandard für die Bewertung von Kundengeschäften in Banken. Seit der Einführung Ende der 1990er-Jahre wurde das System kontinuierlich weiterentwickelt – die Grundstrukturen sind jedoch im Kern unverändert geblieben.
Die Bewertung folgt der Marktzinsmethode, das Deckungsbeitragsschema gliedert sich typischerweise in folgende Stufen:

- Ergebnis nach Zins
- Ergebnis nach Liquiditätsspread
- Ergebnis nach kalkulatorischen Risikokosten
- Ergebnis nach Standardstückkosten
- Ergebnis nach Eigenkapitalkosten
Aktuelle Situation: Negative Margen trotz marktgerechter Konditionen
In den letzten Releases wurden insbesondere die Liquiditätsspreads und die RWA-basierten Eigenkapitalkosten als neue Komponenten eingeführt. In der Praxis zeigt sich bei vielen Instituten, dass seitdem selbst marktübliche Kundenkonditionen – insbesondere auf der Aktivseite – regelmäßig zu negativen Margen führen. Dieses Phänomen lässt sich in allen begleiteten Parametrisierungen beobachten.
Positiv betrachtet, kann dies für Banken mit einem Aktivüberhang eine steuerungswirksame Wirkung entfalten, da Aktivgeschäft an Attraktivität verliert. Problematisch ist jedoch, dass dieselbe Wirkung auch Banken mit einem Passivüberhang trifft, wodurch Aktivgeschäft generell unattraktiv wird.
Regulatorische Implikationen: Verstoß gegen MaRisk
Dauerhaft negative Deckungsbeiträge stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der MaRisk. Gemäß MaRisk BTO 1.2 (TZ 7) muss die Konditionengestaltung:
- den Risikoappetit und die Geschäftsstrategie der Bank berücksichtigen,
- alle relevanten Kostenkomponenten einbeziehen,
- angemessen dokumentiert, gesteuert und überwacht werden.
Die Kundenkondition muss also zwingend zu einem positiven Deckungsbeitrag führen. Zudem können kalkulatorische Risikokosten nach BFA 7 nur dann PWB-reduzierend berücksichtigt werden, wenn sie tatsächlich verdient werden – bei negativer Netto-Marge ist dies nicht der Fall.
Damit stehen Banken faktisch vor einem Dilemma:
- Entweder sie akzeptieren bewusst negative Netto-Margen (Verstoß gegen MaRisk),
- oder sie blenden bestimmte Deckungsbeitragskomponenten aus (Verstoß gegen die Systematik von VR-Control und potenziell ebenfalls gegen MaRisk).
Diese Liste ist auf keinen Fall vollständig. Aber sie zeigt zwei Problemstellungen:
- kann eine gewünschte Marge gar nicht vereinnahmt werden, weil der Kunde nur 3,2 Prozent zahlen kann oder möchte.
- hätte die Bank eine höhere Marge erzielen können, weil der Kunde auch 3,8 Prozent gezahlt hätte.
Ursachenanalyse
Das Problem tritt seit der Einführung von Liquiditätsspreads und RWA-basierten Eigenkapitalkosten verstärkt auf. Die Ursachen liegen jedoch in mehreren Komponenten:
- Konditionsbeitrag:
Es ist fraglich, ob die verwendeten Bewertungskurven tatsächlich die Refinanzierungs- und Wiederanlageopportunitäten der einzelnen Banken abbilden. Für Primärinstitute der Genossenschaftlichen FinanzGruppe dürfte dies am ehesten bei Verwendung der DZ-Bank-Kurve gegeben sein. - Ergebnis nach Liquiditätsspread:
Der Spread ergibt sich typischerweise aus der Differenz zwischen der Bewertungskurve (z. B. 6M-Swap) und der DZ-Bank-Kurve. Diese Differenz kann erheblich sein und ist häufig die größte Belastung des Deckungsbeitrags. Diskutiert wird, ob sich die Höhe des Spreads stärker an der tatsächlichen Refinanzierungsstruktur der Bank orientieren sollte – was jedoch eine Abkehr vom reinen Opportunitätsprinzip der Marktzinsmethode bedeuten würde. Ebenfalls denkbar ist eine Verwendung der Pfandbriefkurve zur Ableitung von Liquiditätsspreads. Dafür spricht die Tatsache, dass das Ausfallrisiko eines Primärinstituts mit dem eines Pfandbriefgeschäftes vergleichbar ist. Dagegen, dass eine Refinanzierung in den meisten Fällen zu diesen Kursen nicht möglich ist. - Ergebnis nach kalkulatorischen Risikokosten:
Diese hängen stark von den zugrunde gelegten Risikoparametern ab (z. B. Migrations- und Ausfallwahrscheinlichkeiten). Hier stehen sich zwei Anforderungen gegenüber:- konservative Einschätzung zur Vermeidung von Risiko-Unterschätzung,
- realistische Einschätzung zur Vermeidung adverser Selektion im risk-adjusted Pricing.
Aufgrund der regulatorischen Dominanz der Adressrisikosteuerung werden Parameter oft zu konservativ angesetzt – mit dem Risiko systematisch zu geringen Margen.
- Ergebnis nach Standardstückkosten:
Die hinterlegten Kostenprofile werden in vielen Banken nicht regelmäßig überprüft. Häufig unterschätzen sie die tatsächlichen Vollkosten. Eine einfache Plausibilisierung kann durch ein Backtesting erfolgen:
Für ein zehnjähriges Darlehen mit insgesamt etwa 20 Arbeitsstunden (Eröffnung, Betreuung, Schließung) und einem Vollkostensatz von rund 100 € pro Stunde sollten die Standardstückkosten etwa 2.000 € betragen. Liegen die Werte darüber, können die Standardstückkosten reduziert werden, liegen sie deutlich darunter, decken sie die erwarteten Kosten nicht ab. - Ergebnis nach Eigenkapitalkosten:
Es ist zu hinterfragen, ob zusätzlich zu kalkulatorischen Risikokosten überhaupt Eigenkapitalkosten anzusetzen sind.
Nach IDW BFA 7 stellen kalkulatorische Risikokosten Rückstellungen für erwartete Verluste dar, aus denen Eigenkapital gebildet wird. Ein zusätzlicher Ansatz von Eigenkapitalkosten könnte somit eine Doppelbelastung darstellen.
Handlungsempfehlung
Da derzeit keine befriedigende Lösung existiert, empfiehlt es sich:
- Auf eine Iteration des Kundenzinses auf eine Ziel-Nettomarge nach Eigenkapitalkosten zu verzichten, insbesondere auf der Aktivseite.
- Die Parametrisierung der Liquiditätsbeiträge und der RWA-basierten Eigenkapitalkosten dennoch systematisch vorzunehmen, um eine belastbare Historie der Komponenten in der Nachkalkulation aufzubauen.
Auch wenn sich das Deckungsbeitragsschema oder einzelne Berechnungslogiken künftig ändern sollten, bleibt eine konsistente historische Datengrundlage entscheidend für die Weiterentwicklung des Steuerungsmodells.
Für Rückfragen zur praktischen Umsetzung und Unterstützung bei der Parametrisierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für Rückfragen zur Vorgehensweise und für eine Unterstützung bei der Parametrisierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Deckungsbeitragsrechnung zählt zu Lars Holzgraefes Leidenschaften. Die bestehende Problematik findet er nach 25 Jahren intensiver Arbeit mit VR-Control gleichermaßen verstörend wie herausfordernd. Sollten Sie die Herausforderung mit ihm angehen wollen, steht er für einen Austausch gerne zur Verfügung