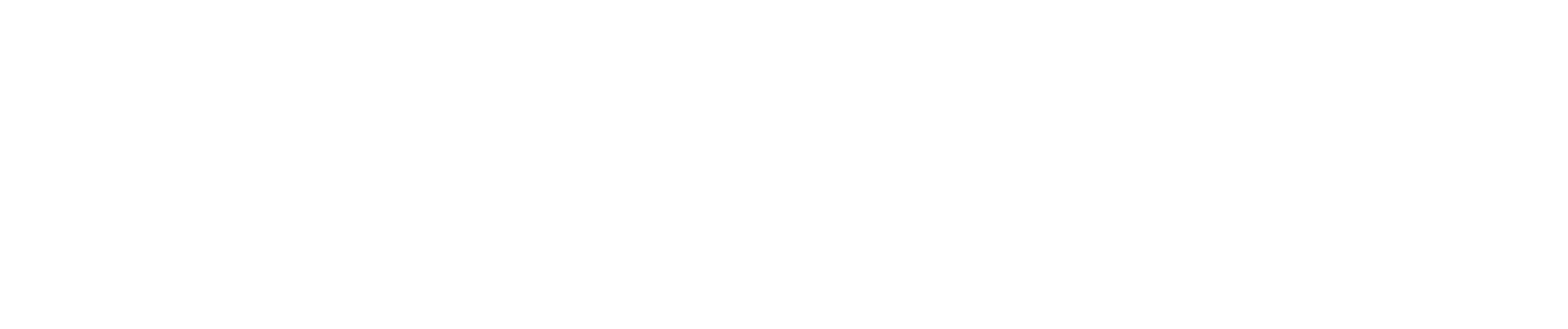Umgang mit Modellrisiken im Adressrisiko Kundengeschäft
02. September 2025
Die Verwendung von Modellen dient nicht nur der Steuerung von Risiken. In der Verwendung von Modellen stecken auch eigene Risiken. Und diese können plötzlich, unerwartet und auch heftig schlagend werden. Aber das ist ja die Eigenart von Risiken. Darüber, wie man am besten mit Modellrisiken umgeht und warum man dies nicht auf die lange Bank schieben sollte, schreibt unser Autor Lars Holzgraefe.

Wachsende Komplexität erhöht die Modellrisiken
An der Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sind Teams von Mathematikern, Physikern und Raketenwissenschaftlern beteiligt. Die Funktionsweise von diesen Modellen vollständig zu durchdringen, ist für Anwender schon lange nicht mehr möglich.
Das komplexe Zusammenspiel von Modellen und wird für den Anwender mehr und mehr zu einer Blackbox. Damit steigt das Risiko, dass in verwendeten Modellen Fehler stecken. Aber selbst die Bewertung dieser Fehler, sofern sie bekannt werden, wird angesichts der Komplexität der Modelle immer schwieriger.
Dies kann nur zu einer Fehlallokation von Risikokapital oder sogar zu der unnötigen Reduktion von freiem Risikokapital führen. Und zusätzlich verstößt dies gegen regulatorische Anforderungen, welche in AT 4.3.5 Tz. 2, neben der regelmäßigen Angemessenheitsüberprüfung, auch hinreichende Kenntnisse über die Modell-Konzeption, insbesondere zu wesentlichen Annahmen und Parametern sowie den darin einfließenden Daten, voraussetzen.
Nehmen Sie die Angemessenheitsnachweise ernst!
Der jährliche Angemessenheitsnachweis ist häufig nur eine lästige Pflichtübung. Selbst die Bewertung von Validierungsberichten erfordert tiefgreifende Fachkenntnisse und viel Zeit. Sich mit dem Angemessenheitsnachweis auseinanderzusetzen, erhöht aber in jedem Fall das Verständnis für das Modell und ermöglicht, eine kritische Bewertung.
Sich Unterstützung bei dem Angemessenheitsnachweis zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, Dummheit oder Faulheit. Der Austausch mit Experten reduziert den Arbeitsaufwand, kann den Nutzen einer Anwendung erhöhen, die hinreichende Kenntnis gewährleisten und aufsichtliche Anforderungen erfüllen.
Verstehen Sie Sensitivitäten!
Neben der Zusammensetzung Ihres Portfolios reagieren die Ergebnisse von Kreditportfoliomodellen auch auf die verwendeten Parameter. Viele dieser Parameter sind selbst abgeleitet, viele sind exogen vorgegeben.
Das Modell reagiert über jeden Parameter und jede Einstellung unterschiedlich. Und die Reaktion ist nicht bei jeder anwendenden Bank identisch. Lernen Sie, auf welche Parameter und Einstellungen das Modell am stärksten reagiert. Konzentrieren Sie das Modellverständnis und Prüfungsaktivitäten auf diese Parameter.
Reagieren Modelle kaum auf die Variation eines Parameters, spielt dieser im Modell offensichtlich keine bedeutende Rolle. Möglicherweise liegt hier eine Modellschwäche vor, weil die Verwendung eines Parameters vermeintlich unnötig ist. Wegen einer unbedeutenden Auswirkung sind solche Probleme aber von geringerer Bedeutung.
Sie sind sich unsicher, ob einer der verwendeten Parameter des Modells korrekt ist. Möglichweise liegen Meldungen vor, die das Risiko ungenauer oder sogar falscher Parameter nahelegen.
Führen Sie Sensitivitätsanalysen dieser Parameter durch. Ist die Abhängigkeit Ihrer Steuerungsgrößen von diesen Parametern bedeutend, hinterfragen sie die verwendeten Parameter gründlich. Erscheint Ihnen ein Wert kritisch, nutzen Sie ggf. Sicherheitsauf- bzw. -abschläge für diese Parameter.
Ist die Abhängigkeit gering, dokumentieren Sie dies und verschwenden Sie keine weiteren Gedanken auf das Thema! Und von einer pauschalen und unreflektierten Verwendung von Auf- und Abschlägen sollte insbesondere vor dem Hintergrund von Risikokapital als knappe Ressource grundsätzlich Abstand genommen werden.
Bewerten Sie Migrationen und Änderungen der Parameter-Sets!
Gerade bei jungen Modellen besteht die Gefahr von „Kinderkrankheiten“. Dies führt zu regelmäßigen Anpassungen der Modelle und der verwendeten Parametersätze. Jede Migration und jede Anpassung eines Parameterdatensatzes führt zu zum Teil nicht unerheblichen Änderungen der Ergebnisse dieses Modells.
Für ein Modellverständnis ist es sinnvoll, die Auswirkungen zu messen und zu analysieren. Welche Teile des Portfolios sind stärker betroffen, welche weniger stark? Welche Parameteränderungen haben große Auswirkungen, welche geringere?
Tauschen Sie auch mit anderen Banken aus. Nicht alle Banken sind gleich stark betroffen. Die Erkenntnis, welche Portfolios stärker auf Migrationen und Änderungen von Parametern reagieren als andere, erhöht das Modellverständnis.
Integrieren Sie die Erkenntnisse aus Auswirkungsanalysen in Ihre Angemessenheitsnachweise. Hinterfragen Sie ggf. vor dem Hintergrund Aussagen aus Validierungs- und Prüfungsberichten kritisch.
Auswirkungsanalysen erfordern eine gründliche Vorbereitung und eine gute Zeitplanung. Bedenken Sie, dass für Auswirkungsanalysen möglicherweise das Löschen von kalkulierten Größen und eine Neukalkulation erforderlich sind. Der Brutto-Zeitaufwand liegt entsprechend deutlich oberhalb des Netto-Zeitaufwandes.
Führen Sie ein Backtesting durch!
Kreditportfoliomodelle messen Risiken. Diese Risiken sollten immer ein messbares Pendant auf der Ergebnisseite haben.
Ist als Risiko zum Beispiel die adressrisikoinduzierte Wertschwankung Ihres Risikodeckungspotenzials definiert, ist das Pendant die tatsächliche adressrisikoinduzierte Wertschwankung ihres Risikodeckungspotenzials.
Die Kalkulation eines Risikos, für das die Messung des schlagend gewordenen Risikos nicht möglich ist, reduziert die Relevanz eines Modells in der Steuerung und ist an sich zu hinterfragen.
Überlegen Sie, wie Sie schlagend gewordene Risiken am besten messen und abbilden können. Sorgen Sie hier für eine möglichst gute Datenqualität und sorgen Sie für den Aufbau möglichst langer Historien für eine Ex-Post-Bewertung der ex ante kalkulierten Risiken.
Zeigt Ihnen Ihr Backtesting, dass Risiken dauerhaft ex post deutlich gering ausgelastet waren, zeigt dies, dass ein Modell an sich konservativ wirkt und die Anfälligkeit für Modellrisiken gering ist.
Entwickeln Sie einen Plan B!
Es ist immer besser, mehrere Eisen im Feuer zu haben.
Sich in der Steuerung von einem wenig transparenten Modell abhängig zu machen, erhöht die Anfälligkeit für unerkannte Modellrisiken.
Gerade in solchen Fällen ist für die Verwendung eines Modells ein Prozess zur Steuerung dieser Modellrisiken zu implementieren. Hierbei steht nicht die Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen im Vordergrund, auch wenn dies ein positiver Nebeneffekt ist. Es geht darum, Modellrisiken erkennen und steuern zu können! Prozesse, welche in Abhängigkeit von der Modellkomplexität und den Ergebnissen der Validierung mit entsprechenden Ampelsystemen arbeiten, helfen dabei die Komplexität zu reduzieren und den Umgang mit Modellrisiken händelbar zu machen.
Überlegen Sie sich, ob es eine alternative Möglichkeit gibt, Risiken zu quantifizieren und das schlagend werdende Adressrisiko aktiv zu steuern. Vertrauen Sie einerseits auf Ihr Bauchgefühl und nutzen Sie andererseits die neuen Möglichkeiten von Big Data und Künstlicher Intelligenz.
Sich gedanklich von einem Anbieter oder Dienstleister abhängig zu machen, erhöht das Risiko, selbst blind für Modellrisiken zu werden.
Lars Holzgraefe nutzt leidenschaftlich gerne Modelle für viele Aspekte der Kundengeschäftssteuerung. Sowohl in der Deckungsbeitragsrechnung als auch in der Adressrisikosteuerung hat er im Laufe seines Berufslebens auch an der Entwicklung solcher Modelle mitgewirkt. Und das hat ihn auch gelehrt, solchen Modellen stets kritisch gegenüberzustehen.